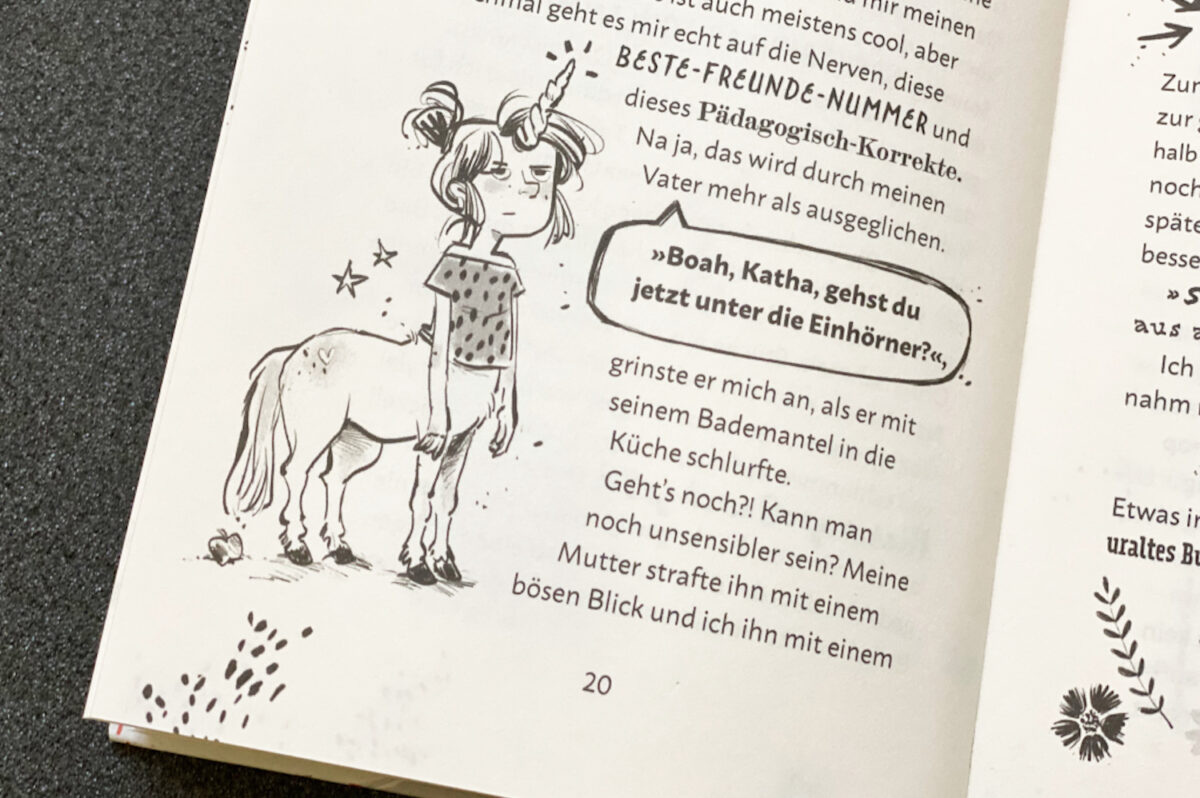Der in der Aargauer Zeitung vom 7. März 2023 erschienene Artikel über die Kinofamilie Baumann «Kinofamilie behauptet sich mit Charme» bietet Anlass, sich mit den Veränderungen rund um die ehemalige Bleichescheune und den ehemaligen Gasthof Löwen zu befassen.
Die Bleichescheune war ein imposanter, architektonisch wohl proportionierter Zweckbau, den wir leider heute nicht mehr bewundern können.
Die 1685 von Hans Martin Hünerwadel gegründete Bleicherei am Bleicherain und die 1732 von Marx Hünerwadel eingerichtete Indienne-Druckerei waren die ersten frühindustriellen Betriebe, die Lenzburg vor allem im 18. Jahrhundert grossen Reichtum brachten. Wir werden uns mit dem Bleichebetrieb in einer der nächsten «Zeitreisen» befassen, und zwar im Zusammenhang mit dem Umbau der heute noch existierenden ehemaligen Bleicherei-Fabrikgebäude am Aabach für die Schule. Heute beschäftigen wir uns mit der zur Bleiche gehörenden grossen ehemaligen Scheune.
Wieso gehörte zur Bleiche eine so grosse Scheune? Der Bleichebetrieb umfasste nicht nur die umfangreichen Gebäude nördlich und südlich des Bleicherains am Aabach. Für das Bleichen der gewobenen Baumwolltücher an der Sonne dienten ausgedehnte Ländereien, die sich nach Westen bis an die Augustin Keller-Strasse und nach Norden bis ins Gebiet der späteren Konservenfabrik Hero (heute Quartier «Im Lenz») erstreckten. Von der Bleicherei zeugen heute noch der Quartiername «Bleichematt» und die Strassennamen Bleicherain und Bleichemattstrasse. Die gesamte Schulanlage Angelrain wie auch die katholische Kirche und die Konservenfabrik Hero wurden auf Arealen errichtet, die einst zum Bleichereibetrieb der Hünerwadel gehörten.
Diese Flächen dienten nicht nur dem Bleichen der Tücher, sondern sie wurden auch landwirtschaftlich bewirtschaftet. Hinzu kamen Reben am Osthang des Goffersbergs und bewirtschaftete Waldstücke in der Umgebung. Auch das Verbringen und Einholen der Tücher zum Bleichen auf den Feldern erforderte viele Fuhren. Daher wurden im Stall 6 Pferde und 12 Kühe gehalten. Dieser stattliche Landwirtschafts- und Fuhrbetrieb erforderte eine entsprechende grosse Scheune. Diese war denn auch so solid und grosszügig gebaut wie das Dr. Müller-Haus am Bleicherain (errichtet vom Bleicheherrn Gottlieb Hünerwadel) und das Hünerwadelhaus am Freischarenplatz.
Leider stand diese Scheune sehr nahe am Bleichrain und kam daher dem zunehmenden Autoverkehr in den Weg. Da der Bleichereibetrieb um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert liquidiert worden war, war auch die Scheune überflüssig geworden. Und so ist in der Chronik der Lenzburger Neujahrsblätter 1947 am 22. August 1946 festgehalten: «Rob. Baumann (Kinobesitzer) hat die Bleichescheune gekauft und gedenkt auch dort ein Lichtspielhaus zu bauen.»
Die Scheune wurde im Winter 1946/47 abgebrochen. Im August 1947 bewilligte der Stadtrat das Baugesuch für den Neubau des Kinos Urban. Dieser wurde 1948 in Betrieb genommen.
Neben dem Kino Urban erhob sich in einem etwas tiefer liegenden Garten das sogenannte «Clavadetscher-Haus», benannt nach seinem langjährigen letzten Eigentümer Urs Clavadetscher. Dieses im 19. Jahrhundert erbaute Gebäude gehörte ebenfalls zum Bleiche-Ensemble und diente den Nachfahren von Gottlieb Hünerwadel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wohnsitz. Denn das grosse Hünerwadelhaus am Bleicherain, das heutige Müller-Haus, musste 1849 nach dem Konkurs von Major Rudolf Hünerwadel, der in der Liegenschaft eine Bierbrauerei betrieben hatte, an Louis Mojon verkauft werden. Erst 1879 kaufte Walter Hünerwadel-Stephani das von seinem Urgrossvater errichtete prächtige Gebäude zurück.
Das Haus stand genau dort, wo heute die Kernumfahrung zwischen dem Kino Urban und den entlang dem Aabach verbliebenen letzten Bauten der Bleiche in den Tunnel «Angelrain» führt. Das an sich schöne, aber baufällig gewordene Haus fiel daher 1999 der Spitzhacke zum Opfer. Wo es einst stand, stehen heute die aus dem Tunnel kommenden Motorfahrzeuglenker vor den roten Ampeln und warten ungeduldig auf das grüne Signal zur Weiterfahrt, sofern sie nicht freie Fahrt haben. Die zierlichen runden Säulen, welche die Terrasse vor dem Haus stützten, sind erhalten geblieben. Sie haben im Garten des Nachbarhauses Bleicherain 2 eine neue Aufgabe gefunden: Sie stützen dort eine Pergola.
Während Jahrhunderten war der Gasthof zum Löwen das bedeutendste Gasthaus der Stadt. Hier stieg ab, wer in Lenzburg nicht in privaten Haushaltungen untergebracht war. Das Gebäude bildete den oberen Abschluss der Rathausgasse und hatte damit eine dominante Stellung. Erst mit der Eröffnung des Gasthofs Krone im Jahre 1772 erhielt der Gasthof Löwen eine ernsthafte Konkurrenz. Der Gasthof Krone lag ausserhalb der Stadtmauern und konnte somit auch dann Gäste aufnehmen, wenn die Tore längst geschlossen waren.
Wenn wir das Bild des Hotels Löwen näher betrachten, fällt eine Anschrift rechts oben, neben der Türe auf: «Eigene Stallungen». Verfügt das Hotel Ochsen heute über einen grossen Parkplatz oder das Hotel Krone über eine Tiefgarage, wo die Gäste ihre motorisierten Pferdestärken abstellen können, so war man seinerzeit noch mit natürlichen Pferdestärken unterwegs, nämlich als Reiter oder mit Ross und Wagen. Ein Gasthof musste daher über Pferdestallungen verfügen. Wie wir aus Schilderungen in der Lenzburger Literatur wissen, lagen die Pferdestallungen seinerzeit unmittelbar hinter dem Gasthof Löwen im Brättligäu. Von den Stallungen her gab es eine Treppe direkt in den ersten Stock des Gebäudes. Hier war auch der Tanzsaal, wo ein Tanzmeister der Lenzburger Jugend das Tanzen und die Umgangsformen beibrachte. Leider verfügen wir über keine Fotografie dieser Stallungen. Natürlich hatte auch das Hotel Krone ursprünglich solche Stallungen. Diese befanden sich am Sandweg dort, wo um 1970 gegenüber vom Försterhaus der neue Hoteltrakt errichtet wurde. Auf einer alten Aufnahme kann man dieses Oekonomiegebäude noch erkennen (siehe Titelbild).
Nach 1900 befand sich der Gasthof Löwen in Schwierigkeiten. Die Wirtin, Witwe Raible, veräusserte den Gasthof 1907 einem Wirt namens Walser aus St. Gallen. Offenbar lief das Geschäft aber nicht so, wie es sollte. Der Vertrag wurde vom Obergericht 1910 als unverbindlich erklärt, und Witwe Raible musste das Gebäude wieder übernehmen. Dies führte zum Konkurs. Aus diesem erwarben 1911 die Erben des Jean Stöckli, der zuletzt im «Löwen» gewirtet hatte, die Liegenschaft.
Im Gebäude wurde 1918 unter dem Namen «Löwen-Lichtspiele» ein Kino eröffnet. 1927 übernahm Robert Baumann diesen Betrieb, der bis heute unter dem Namen Lichtspieltheater AG weitergeführt wird. 1955 wurde das links anstossende Gebäude für den Bau eines Treppenhauses und Foyers für den Kino einbezogen, wie wir der Chronik 1954/55 in den Lenzburger Neujahrsblättern 1957, S. 79, entnehmen können: 30. November 1954: «In der oberen Häuserzeile der Altstadt gähnt eine Lücke: das heimelige Haus der Gemüsehandlung Zobrist wurde bis auf den Grund abgetragen, um Raum zu schaffen für Foyer und Treppenhaus des anstossenden Lichtspieltheaters.»
Die Chronik der Lenzburger Neujahrsblätter belegt auch, dass im Laufe der Jahre in den Kinos Löwen und Urban neben dem normalen Kinobetrieb zahlreiche Veranstaltungen mit speziellen Vorführungen stattfanden. Belegt ist aber auch, dass die Lichtspieltheater AG den technischen Fortschritt mitmachte: «Im Löwenkino gibt’s jetzt die modernste Tonfilmapparatur, die Europa-Junior» (März 1937, Lenzburger Neujahrsblätter 1938, S. 77).
Trotz enormer Konkurrenz durch Fernsehen und Internet hat sich die Lichtspieltheater AG mit ihren zwei Kinos in Lenzburg bis heute behauptet und erlaubt es nach wie vor, Filme zusammen mit anderen Gleichgesinnten zu erleben.
Von der Bleichescheune zum Kino Urban
Die Bleichescheune war ein imposanter, architektonisch wohl proportionierter Zweckbau, den wir leider heute nicht mehr bewundern können.

Die ehemalige Bleichescheune, 1946. Rechts daran angebaut der Wohntrakt. Quelle: Fotoband Liebes altes Lenzburg, 1986, Seite 90.
Die 1685 von Hans Martin Hünerwadel gegründete Bleicherei am Bleicherain und die 1732 von Marx Hünerwadel eingerichtete Indienne-Druckerei waren die ersten frühindustriellen Betriebe, die Lenzburg vor allem im 18. Jahrhundert grossen Reichtum brachten. Wir werden uns mit dem Bleichebetrieb in einer der nächsten «Zeitreisen» befassen, und zwar im Zusammenhang mit dem Umbau der heute noch existierenden ehemaligen Bleicherei-Fabrikgebäude am Aabach für die Schule. Heute beschäftigen wir uns mit der zur Bleiche gehörenden grossen ehemaligen Scheune.
Wieso gehörte zur Bleiche eine so grosse Scheune? Der Bleichebetrieb umfasste nicht nur die umfangreichen Gebäude nördlich und südlich des Bleicherains am Aabach. Für das Bleichen der gewobenen Baumwolltücher an der Sonne dienten ausgedehnte Ländereien, die sich nach Westen bis an die Augustin Keller-Strasse und nach Norden bis ins Gebiet der späteren Konservenfabrik Hero (heute Quartier «Im Lenz») erstreckten. Von der Bleicherei zeugen heute noch der Quartiername «Bleichematt» und die Strassennamen Bleicherain und Bleichemattstrasse. Die gesamte Schulanlage Angelrain wie auch die katholische Kirche und die Konservenfabrik Hero wurden auf Arealen errichtet, die einst zum Bleichereibetrieb der Hünerwadel gehörten.
Diese Flächen dienten nicht nur dem Bleichen der Tücher, sondern sie wurden auch landwirtschaftlich bewirtschaftet. Hinzu kamen Reben am Osthang des Goffersbergs und bewirtschaftete Waldstücke in der Umgebung. Auch das Verbringen und Einholen der Tücher zum Bleichen auf den Feldern erforderte viele Fuhren. Daher wurden im Stall 6 Pferde und 12 Kühe gehalten. Dieser stattliche Landwirtschafts- und Fuhrbetrieb erforderte eine entsprechende grosse Scheune. Diese war denn auch so solid und grosszügig gebaut wie das Dr. Müller-Haus am Bleicherain (errichtet vom Bleicheherrn Gottlieb Hünerwadel) und das Hünerwadelhaus am Freischarenplatz.
Leider stand diese Scheune sehr nahe am Bleichrain und kam daher dem zunehmenden Autoverkehr in den Weg. Da der Bleichereibetrieb um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert liquidiert worden war, war auch die Scheune überflüssig geworden. Und so ist in der Chronik der Lenzburger Neujahrsblätter 1947 am 22. August 1946 festgehalten: «Rob. Baumann (Kinobesitzer) hat die Bleichescheune gekauft und gedenkt auch dort ein Lichtspielhaus zu bauen.»

Blick auf die in den Strassenraum des Bleicherains hineinragende Bleichescheune; rechts erkennt man das Clavadetscher-Haus. Quelle: Museum Burghalde, Fotoalbum Karl Urech
Die Scheune wurde im Winter 1946/47 abgebrochen. Im August 1947 bewilligte der Stadtrat das Baugesuch für den Neubau des Kinos Urban. Dieser wurde 1948 in Betrieb genommen.
Der Verkehr fordert ein weiteres Opfer
Neben dem Kino Urban erhob sich in einem etwas tiefer liegenden Garten das sogenannte «Clavadetscher-Haus», benannt nach seinem langjährigen letzten Eigentümer Urs Clavadetscher. Dieses im 19. Jahrhundert erbaute Gebäude gehörte ebenfalls zum Bleiche-Ensemble und diente den Nachfahren von Gottlieb Hünerwadel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wohnsitz. Denn das grosse Hünerwadelhaus am Bleicherain, das heutige Müller-Haus, musste 1849 nach dem Konkurs von Major Rudolf Hünerwadel, der in der Liegenschaft eine Bierbrauerei betrieben hatte, an Louis Mojon verkauft werden. Erst 1879 kaufte Walter Hünerwadel-Stephani das von seinem Urgrossvater errichtete prächtige Gebäude zurück.

Das Clavadetscher-Haus, aufgenommen 1981 von der Seonerstrasse her. Quelle: Fotosammlung Stadtbauamt
Das Haus stand genau dort, wo heute die Kernumfahrung zwischen dem Kino Urban und den entlang dem Aabach verbliebenen letzten Bauten der Bleiche in den Tunnel «Angelrain» führt. Das an sich schöne, aber baufällig gewordene Haus fiel daher 1999 der Spitzhacke zum Opfer. Wo es einst stand, stehen heute die aus dem Tunnel kommenden Motorfahrzeuglenker vor den roten Ampeln und warten ungeduldig auf das grüne Signal zur Weiterfahrt, sofern sie nicht freie Fahrt haben. Die zierlichen runden Säulen, welche die Terrasse vor dem Haus stützten, sind erhalten geblieben. Sie haben im Garten des Nachbarhauses Bleicherain 2 eine neue Aufgabe gefunden: Sie stützen dort eine Pergola.

Das Clavadetscher-Haus, aufgenommen 1997 von Südosten; gut zu erkennen sind die im Text erwähnten runden Säulen der Terrasse. Quelle: Museum Burghalde, Fotosammlung Nussbaum
Der Gasthof Löwen
Während Jahrhunderten war der Gasthof zum Löwen das bedeutendste Gasthaus der Stadt. Hier stieg ab, wer in Lenzburg nicht in privaten Haushaltungen untergebracht war. Das Gebäude bildete den oberen Abschluss der Rathausgasse und hatte damit eine dominante Stellung. Erst mit der Eröffnung des Gasthofs Krone im Jahre 1772 erhielt der Gasthof Löwen eine ernsthafte Konkurrenz. Der Gasthof Krone lag ausserhalb der Stadtmauern und konnte somit auch dann Gäste aufnehmen, wenn die Tore längst geschlossen waren.

Das Hotel Löwen um 1917; links das 1954 abgetragene Haus mit der Gemüsehandlung L. Zobrist-Siegrist.
Quelle: Fotoband Liebes altes Lenzburg, Seite 17
Wenn wir das Bild des Hotels Löwen näher betrachten, fällt eine Anschrift rechts oben, neben der Türe auf: «Eigene Stallungen». Verfügt das Hotel Ochsen heute über einen grossen Parkplatz oder das Hotel Krone über eine Tiefgarage, wo die Gäste ihre motorisierten Pferdestärken abstellen können, so war man seinerzeit noch mit natürlichen Pferdestärken unterwegs, nämlich als Reiter oder mit Ross und Wagen. Ein Gasthof musste daher über Pferdestallungen verfügen. Wie wir aus Schilderungen in der Lenzburger Literatur wissen, lagen die Pferdestallungen seinerzeit unmittelbar hinter dem Gasthof Löwen im Brättligäu. Von den Stallungen her gab es eine Treppe direkt in den ersten Stock des Gebäudes. Hier war auch der Tanzsaal, wo ein Tanzmeister der Lenzburger Jugend das Tanzen und die Umgangsformen beibrachte. Leider verfügen wir über keine Fotografie dieser Stallungen. Natürlich hatte auch das Hotel Krone ursprünglich solche Stallungen. Diese befanden sich am Sandweg dort, wo um 1970 gegenüber vom Försterhaus der neue Hoteltrakt errichtet wurde. Auf einer alten Aufnahme kann man dieses Oekonomiegebäude noch erkennen (siehe Titelbild).
Nach 1900 befand sich der Gasthof Löwen in Schwierigkeiten. Die Wirtin, Witwe Raible, veräusserte den Gasthof 1907 einem Wirt namens Walser aus St. Gallen. Offenbar lief das Geschäft aber nicht so, wie es sollte. Der Vertrag wurde vom Obergericht 1910 als unverbindlich erklärt, und Witwe Raible musste das Gebäude wieder übernehmen. Dies führte zum Konkurs. Aus diesem erwarben 1911 die Erben des Jean Stöckli, der zuletzt im «Löwen» gewirtet hatte, die Liegenschaft.
Aus dem Gasthof wird ein Kino
Im Gebäude wurde 1918 unter dem Namen «Löwen-Lichtspiele» ein Kino eröffnet. 1927 übernahm Robert Baumann diesen Betrieb, der bis heute unter dem Namen Lichtspieltheater AG weitergeführt wird. 1955 wurde das links anstossende Gebäude für den Bau eines Treppenhauses und Foyers für den Kino einbezogen, wie wir der Chronik 1954/55 in den Lenzburger Neujahrsblättern 1957, S. 79, entnehmen können: 30. November 1954: «In der oberen Häuserzeile der Altstadt gähnt eine Lücke: das heimelige Haus der Gemüsehandlung Zobrist wurde bis auf den Grund abgetragen, um Raum zu schaffen für Foyer und Treppenhaus des anstossenden Lichtspieltheaters.»
Die Chronik der Lenzburger Neujahrsblätter belegt auch, dass im Laufe der Jahre in den Kinos Löwen und Urban neben dem normalen Kinobetrieb zahlreiche Veranstaltungen mit speziellen Vorführungen stattfanden. Belegt ist aber auch, dass die Lichtspieltheater AG den technischen Fortschritt mitmachte: «Im Löwenkino gibt’s jetzt die modernste Tonfilmapparatur, die Europa-Junior» (März 1937, Lenzburger Neujahrsblätter 1938, S. 77).
Trotz enormer Konkurrenz durch Fernsehen und Internet hat sich die Lichtspieltheater AG mit ihren zwei Kinos in Lenzburg bis heute behauptet und erlaubt es nach wie vor, Filme zusammen mit anderen Gleichgesinnten zu erleben.
Titelbild: Sandweg Lenzburg; in der Bildmitte erkennt man als Abschluss der linken Häuserzeile das ehemalige Oekonomiegebäude des Hotels Krone
Quelle: Gruss aus Lenzburg, vergangene Zeiten in Ansichtskarten, 1996, Ortsbürgerkommission Lenzburg und Stiftung Museum Burghalde, Seite 72
Quelle: Gruss aus Lenzburg, vergangene Zeiten in Ansichtskarten, 1996, Ortsbürgerkommission Lenzburg und Stiftung Museum Burghalde, Seite 72
Über
We Love Lenzburg macht jeden Monat eine Reise ins vergangene Lenzburg.
Christoph Moser, 75, war von 1979 bis 2010 Lenzburger Stadtschreiber.
Seit seiner Pensionierung betreut er das Stadtarchiv, verfasst Vorträge zu historischen Themen und wirkt als Stadtführer. Sein Motto: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart besser zu verstehen.